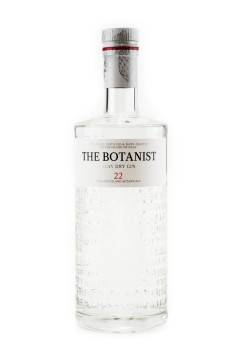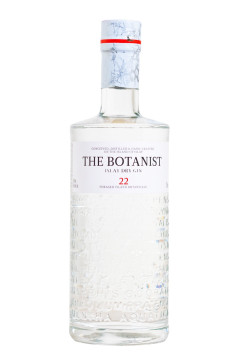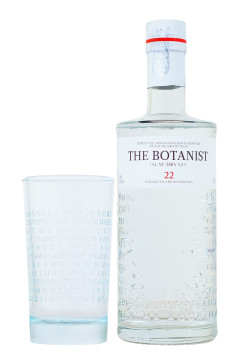The Botanist

Der schottische Botanist ist der erste und auch einzige Gin aus der eigentlich Whisky Region Islay. Das macht ihn zu etwas besonderem. Der Botanist Gin besticht am meisten durch sein außergewöhnliches Flaschendesign, was schon viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Neben neun klassischen Gin Botanicals wie Wacholder, kommen auch noch 22 lokale Kräuter und Blüten in den Gin. So gestaltet sich ein sehr eigener, besonderer Geschmack. Destilliert wird der Gin sehr langsam, um seinen milden Geschmack zu garantieren.
Inhalt: 0.7 l (57,59 €* / 1 l)
Dieser Gin stammt aus der Bruichladdich Distillery und stammt damit von der schottischen Insel Islay. Mit der Entwicklung des Gins wurde das Ziel gesetzt, den einzigartigen natürlichen Charakter der Insel geschmacklich einzufangen. Mithilfe einer kleinen Gruppe von Barkeepern wurde ein einzigartiger Geschmack kreiert, der vergessene Geschmacksrichtungen und rohe Sinne wiedererweckt. Hergestellt wird der Gin aus insgesamt einunddreißig Kräutern und Gewürzen, von denen neun elementare Kräuter der Gin-Zubereitung sind.
Gin und Schottland wie passt das zusammen?
Inspiriert und maßgeblich beeinflusst durch die Barkeeper Thomas Aske und Ally Kelsay, Forager und Futtertutor Mark Williams und die Köche Craig Grozier und Jack Buchanan, stellte man sich mit The Botanist die Herausforderung, den Geschmack zu entdecken, der im eigenen Garten verborgen liegt. Spezifisch bezog sich diese Idee auf die Gärten der Bewohner von Islay. Als Gegenbewegung zur industriellen Abfertigung und Kommerzialisierung von Lebensmitteln, sollte The Botanist zurück zu den Ursprüngen führen, zurück zur Nahrungssuche im Freien. Der Idee nach „food for free“ wurde The Botanist von und für Freigeister entwickelt, für jene, die noch immer im Herbst Brombeeren sammeln, im Spätsommer Pilze suchen oder Brunnenkresse vom Wasserrand sammeln.
Schlammstiefel, schmutzige Fingernägel, unbetretene Pfade, bekannte Hundeschlittentouren, Parks, Bürgerliche, Straßenränder, Gärten, Hecken, Meeresufer, Flussufer, die Inspiration wurde überall gesucht und schließlich auch gefunden. So konnte 2011 der The Botanist Dry Gin auf den Markt eingeführt werden.
Die Herstellung
Die Kräuter für den The Botanist Gin werden von Hand geerntet und sind gänzlich natürlichen und unbehandelten Ursprungs. Lokal werden sogar Touren angeboten, bei denen die Kräuter nicht nur vorgestellt und erklärt werden, sondern auch gemeinsam im Freien gesucht und gesammelt werden sollen. Ebenso viel Wert wie auf die Auswahl der erlesenen Kräuter und Gewürze, legt The Botanist auch auf den Vorgang der Destillation. Von Hand wird die Temperatur geprüft, bei dem die Destillation durchgeführt wird. Ist die richtige Temperatur erreicht, werden die Pflanzenstoffe der Gin-Basis einer bestimmten Reihenfolge nach und manuell in den Topf der Stills gefüllt.
Für eine Dauer von zwölf Stunden werden die Kräuter im Destillat eingeweicht, bevor der Dampfdruck wieder auf Siedepunkt angehoben wird und die Dämpfe beginnen, den Hals des stark modifizierten Behälters hochzuziehen.
Die Dämpfe treffen auf die 85 Kupferrohre treffen, die für ihre Filtration und Reinigung des Dampfes vorgesehen sind. Der Dampf trifft schließlich auf einen Wasserbehälter am Kopf des Destillierkolbens, der die Dämpfe abkühlt und einen Rückfluss von Schwerölen verursacht, die aus dem Kupfer ausgetreten sind. Nur die reinsten und leichtesten Dämpfe gelangen durch das System im sogenannten Lyne Arm. Hier werden die Islay-Kräuter hinzugefügt, die direkt aus der Region stammen. Die Pflanzenextrakte werden in lose gewebte Säcke aus Musselinstoff gefüllt, durch die der Dampf leicht hindurchdringen kann. Der kondensierte Rücklauf des Destillates läuft schließlich den langen Röhrenkondensator hinunter und sammelt sich im sogenannten „Spirit safe“. Hier wird das fertige Destillat von den Still-Meistern kontrolliert.
Die 22 Kräuter
Lokal und nachhaltig gesammelt, handelt es sich bei den zweiundzwanzig Kräutern um heimische Pflanzen der Insel Islay. Nicht nur ihre physikalischen Wurzeln sind Teil der Insel, sondern auch ihre historischen Wurzeln sind tief in der Kultur und dem botanischen Wissen Schottlands verankert. Natürlich spielt der Geschmack der Kräuter für den Botanist Gin auch eine wichtige Rolle. Das Zusammenspiel von insgesamt mehr als einunddreißig Kräutern lässt sich nicht einfach so herbeizaubern. Hier bedarf es die hohe Kunst der schottischen Gin-Spezialisten. Die perfekte Ausgewogenheit des Geschmacks lässt sich nur erreichen, wenn man mit dem Land und seiner Tradition eng verbunden ist. Doch nicht nur an der Verwendung von den zweiundzwanzig einheimischen Kräutern lässt sich die enge Verbundenheit mit der Insel erahnen - Die Destille hat seinen eigenen Spitznamen: „Ugly Betty“.
Die „hässliche Betty“
Die „hässliche Betty“ ist eine Destille, die früher für die Whiskyherstellung verwendet wurde. Eine sogenannte „Lomond Still“, die wie Pot Stills für batch Destillationen verwendet wird. Insgesamt dauert der Destillationsvorgang rund siebzehn Stunden. Thomas Morton, ein schottischer Journalist, beschrieb die Destille als: „Einen auf dem Kopf stehenden Mülleimer aus Kupfer“. Daher rührt auch die Spitznamensgebung. Heutzutage ist Betty die letzte Lomond Destille ihrer Art und damit berühmt!
Die Rundblättrige Minze
Diese Minze wird auch Apfelminze genannt und ist besonders wegen ihres milden und ausgewogenen Geschmacks beliebt. Schon seit der griechischen Antike wurde das Kraut sehr geschätzt und sogar für esoterische und psychoaktive Getränkemischungen bei Zeremonien verwendet. Benannt ist die Minze nach der Wassernymphe Mentha aus der griechischen Mythologie. Diese wurde von der Göttin Persephone auf frischer Tat ertappt, wie sie deren Mann Hades, den Gott der Unterwelt, verführen wollte. Mentha entkam, da sie sich in das süß duftende Kraut verwandelte.
Die Kamille
Das Wort stammt ebenfalls aus dem Griechischen und entstand aus den Worten Kamai für „am Boden liegend“ und Milo für „Apfel“. Die Bezeichnung hat die Blume ihrem süßen, apfelartigen Duft zu verdanken. Schon im Mittelalter wurde die Kamille als Duftstoff verwendet und sollte Hausgerüche mildern.
Die Acker-Kratzdistel
Während einige Distelarten als heilig verehrt wurden, wurde die Kratzdistel oft als Teil des biblischen Fluches auf die Menschheit angesehen, da sie sich aufgrund ihrer fast unaufhaltsamen Kraft außer Kontrolle ausbreitete. Die Distel war jedoch auch ein keltisches Symbol für den Adel und wurde schließlich die Nationalblume Schottlands.
Die Moorbirke
In der keltischen Kultur, insbesondere auf den Hebriden, war die Birke traditionell gleichbedeutend mit Geburt, Liebe und Reinheit, daher wurden Birkenstücke oft über Wiegen gelegt, um die Kinder vor bösen Geistern zu schützen. In der Mythologie legen die Zuschreibungen der Birke von Jugendlichkeit und Liebe nahe, dass sie mit dem keltischen Gott der Liebe, Aonghus Og, in Verbindung gebracht wurde.
Der Holunder
Der Holunder ist wohl einer der mächtigsten Bäume der Mythologie. Judas soll sich an einem Holunder-Baum erhängt haben. Als Folge davon ist der Holunder traditionell mit unglücklichen und bösen Geistern in Verbindung gebracht worden. In vielen Kulturen ist das Verbrennen von Holunderstämmen die Einladung des Teufels in Ihr Zuhause.
Der Stechginster
Der Stechginster wurde lange Zeit als kraftvoll empfunden, besonders in der keltischen Mythologie, die wahrscheinlich Tausende von Jahren bis zur allerersten Zeit der Mythenerzeugung auf den Inseln Großbritannien, Schottland und Irland zurückreicht. Die Dornen wurden als „Häuptlingsbäume" angesehen. Als 17. Buchstabe des alten keltischen Alphabets wird Ginster mit der Reise des Lebens in Verbindung gebracht und repräsentiert vielleicht die dunkleren und militärischeren Qualitäten, die man zum Überleben braucht. Es wird auch gesagt, dass er Energie für die Entscheidungen gibt, die das Leben bieten wird. In der schottischen Region Argyll, der Heimat von The Botanist, ist der Stechginster eng mit der Cailleach, einer göttlichen Hexe, verbunden. Cailleach wird zugeschrieben, dass sie die Landschaft von Argyll mit ihrem Hammer geformt hat.
Der Weißdorn
Seit der Zeit der alten Griechen gilt Weißdorn als das Symbol der Hoffnung, und der populäre Aberglaube sagt, dass die Entwurzelung von Weißdorn Unglück bringt, ebenso wie das Schneiden oder Trimmen zu einem anderen Zeitpunkt, als wenn es in Blüte steht. Der gälischen Folklore nach wächst Weißdorn an Toren in die „Anderswelt“ und ist daher eng mit den Mythen von der Feen und Geistern verbunden. Seltsamerweise gilt der Weißdorn in der serbischen und kroatischen Folklore als besonders tödlich für Vampire und ist das Material der Wahl für den Holzpfahl deines Vampirjägers.
Das Heidekraut
Das lateinische Calluna leitet sich vom griechischen kallunein ab und bedeutet „verschönern“ oder „reinigen" und bezieht sich auf die Tradition, Besen aus Heidezweigen herzustellen. Im 18. Jahrhundert wurde auf Islay teilweise sogar Bier aus den jungen Spitzen der Heide hergestellt, indem zwei Drittel dieser Pflanze mit einem Malz vermischt wurden. Heidekraut war ein Favorit der frühen Pikten und Spuren eines fermentierten Getränks aus Heidekrautblüten wurden auf einer 3.000 Jahre alten Scherbe von Keramik von der Insel Rum gefunden.
Der Wacholder
Wacholder wurde als die Pflanze der Hilfe verehrt - Jesus soll durch einen Wacholderbusch vor dem Zorn des Herodes geschützt worden sein, und Elias wurde von Königin Isebel durch einen Wacholder gerettet, der über eine göttliche Präsenz verfügte. Ein Wacholderstrauch, der an der Haustür gepflanzt wurde, sollte Hexen und Dämonen abwehren und brennende Wacholderzweige reinigten das Haus und hielten Unglück in Schach. Noch heute wird Wacholderöl in der Aromatherapie als besonders einigend angesehen.
Echtes Labkraut
Labkraut wurde vor allem als Färbemittel verwendet, da die Blätter und der Stiel einen leuchtend gelben Farbstoff erzeugen. Auf den Hebriden wurden die Wurzeln traditionell verwendet, um einen leuchtend roten Farbstoff herzustellen, ähnlich dem Krapp, mit dem Wolle gefärbt wurde; der Vorläufer von Harris Tweed.
Die Zitronenmelisse
Heute bekannt als Gemeine Melisse und Zitronenmelisse, ist dies der ursprüngliche „Balsam", ein legendäres ätherisches Öl. Melissa ist griechisch für „Honigbiene“ und die Pflanze wirkt tatsächlich anziehend auf Bienen. Zitronenmelisse ist seit langem als Stärkungsmittel gegen Stress, Depressionen und Ängste bekannt.
Das Mädesüß
Die walisischen Zauberer Math und Gwydion machten eine Braut für Llew Llaw Gyffes aus Mädesüß: „die schönste Jungfrau, die man je gesehen hat“. Mädesüß ist auch in Chaucers „The Knight's Tale" aus dem 14. Jahrhundert enthalten, um ein Getränk aus honigsüßem Bier zu würzen.
Der Beifuß
Seit dem Mittelalter galt Beifuß als mächtiger Schutz gegen wilde Tiere und zufälliges Unheil und soll den Reisenden vor „Müdigkeit, Sonnenstich, wilden Tieren und bösen Geistern" schützen. Einst als Cingulum sancti johannis bekannt, glaubte man, dass Johannes der Täufer einen Gürtel davon in der Wildnis trug, und so konnte am Johannesabend eine Krone aus Beifuß getragen werden, um sich gegen dämonische Besessenheit zu schützen. Beifuß war ein traditionelles Aroma für alkoholische Getränke und wurde vor der Einführung von Hopfen häufig als bindendes Mittel in Bier verwendet.
Der Rotklee
Dies ist die Art des legendären vierblättrigen Klees. Der Legende nach trug Eva bei der Vertreibung aus dem Garten Eden ein vierblättriges Kleeblatt bei sich, weshalb es ein kleines Stück Paradies auf Erden darstellt. Viele der keltischen Völker verehrten das Kleeblatt und glaubten, dass, wenn man ein dreiblättriges Kleeblatt trug, es vor bösen Geistern warnen würde, und ein vierblättriges Kleeblatt würde aktiven Schutz bieten. Ähnlich wurde mittelalterlichen Kindern gesagt, dass ein vierblättriges Kleeblatt seinem Träger ermöglichen würde, Feen zu sehen. In der christlichen Folklore stellt das dreiblättrige Kleeblatt die Heilige Dreifaltigkeit dar und nach St. Patrick symbolisiert das vierte Blatt die Gnade Gottes.
Die Grüne Minze
Obwohl die Grüne Minze bereits seit über 10.000 Jahren für ihre Eigenschaften bekannt ist, wurde sie seltsamerweise erst 1696 in Großbritannien in der Synopsis Stirpium Britannicorum anerkannt. Die grüne Minze ist eines der am meisten geschätzten ätherischen Öle - die Ägypter, Römer und Griechen nahmen es wegen Verdauungsstörungen und Magenbeschwerden ein und es hat sich als eines der wirksamsten Mittel gegen die Erkältung erwiesen, wenn es früh eingenommen wird, normalerweise als Tee.
Die Süßdolde
Die Süßdolde war der Jungfrau Maria heilig und wurde traditionell als Bringer von Freude, Vertrauen und Selbstwertgefühl verehrt. Es wurde sogar für heilige Zeremonien wie Beltaine, dem gälischen Maifest verwendet. John Gerard behauptet in seiner berühmten „Herball, or general historie of plantes" von 1597: „Es ist sehr gut für Menschen, die langweilig und ohne Mut sind; es freut und tröstet das Herz und erhöht ihre Lust und Stärke". Die Essenz der Pflanze gilt als Aphrodisiakum.
Der Gagelstrauch
Vor der Einführung des Hopfens in Großbritannien, und möglicherweise bereits vor dem 11. Jahrhundert, wurde der Gagelstrauch oder auch Talgbaum verwendet, um das Bier zu würzen und mit Bitterkeit zu versehen. Einige glaubten, dass der Gagelstrauch magische Eigenschaften haben, wenn er mit Bier gebraut wurde, und er soll Bestandteil eines Getränks gewesen sein, das von nordischen Kriegern zubereitet wurde, um sie im Kampf furchtlos zu machen. Sie wurden als die Berserker bekannt und sollten in einer unkontrollierbaren tranceartigen Wut gekämpft haben.
Der Rainfarn
Der lateinische Name Tanacetum Vulgare soll vom griechischen Athanaton abgeleitet sein und so viel bedeuten wie „unsterblich". Rainfarn oder auch Wurmkraut genannt, war auch jenes Kraut, das Zeus Ganymed gab, um den schönen Jungen unsterblich zu machen. Ein Rainfarn Kuchen wurde traditionell zu Ostern als gesundes Gegenmittel gegen all den Salzfisch in der Fastenzeit gegessen.
Die Wasserminze
Mentha aquatica ist die häufigste der Minzsorten und wächst an Flussufern und Sümpfen und natürlich in Mooren. Wie bei der grünen Minze ist das ätherische Öl der Wasserminze dafür bekannt, die Spirituosen zu beleben und zu verfeinern.
Der Weißklee
Für die Kelten war der Weißklee eine heilige, magische Pflanze und die Druiden sahen seine drei Blätter als Symbole für Erde, Meer und Himmel an.
Wilder Thymian
Im Mittelalter war Thymian ein Symbol für Tapferkeit und Energie und die Damen bestickten ein Motiv einer Biene, die über einem Thymianzweig schwebte, auf dem Zeichen, das sie ihrem bevorzugten Ritter gaben. Tatsächlich sind Thymian und Bienen schon lange miteinander verbunden, und der Honig von Bienen, die sich von Thymianpollen ernähren, wird schon lange wegen seiner Süße und seines Duftes geschätzt. Der Legende nach ist jeder Ort, an dem Thymian wild wächst, ein Ort, der von den Feen gesegnet wird, und das Kraut wurde verwendet, um einen Raum zu reinigen und um sich auf ein magisches Ritual vorzubereiten.
Salbei-Gamander
Salbei-Gamander oder auch Steppensalbei ist eine Unterart des echten Salbeis „Salvia officinalis".
Cocktailideen
Islay Bramble
Zutaten:
40 ml The Botanist
20 ml Zitronensaft
15 ml Zuckersirup
15 ml Brombeersirup
Einige Brombeeren
Crushed Ice
Eiswürfel
Zubereitung:
In einen Cocktailshaker werden zunächst die Eiswürfel gefüllt. Danach werden der Gin, der Zitronensaft und der Zuckersirup hinzugegeben und die Zutaten mit kräftigem Schütteln miteinander vermischt. Die Mischung wird in ein Cocktailglas abgeseiht und das Glas mit Crushed Ice aufgefüllt. Über das Crushed Ice wird danach der Brombeersirup gegeben und zur Garnierung werden noch einige Brombeeren hinzugefügt.
Pom Gin
Zutaten:
40 ml The Botanist
20 ml Grenadinen-Saft
15 ml Zitronensaft
Eine Blumenblüte
Eiweiß
Eiswürfel
Zubereitung:
Die Zutaten werden ohne Eis in einen Cocktailshaker gegeben und dort durch Schütteln vermischt. Anschließend werden einige Eiswürfel hinzugegeben und alles erneut bis zur vollständigen Abkühlung im Shaker geschüttelt. Danach wird der Cocktail in ein Coupéglas abgeseiht und mit einer Blumenblüte wie einer Bechermalve garniert.